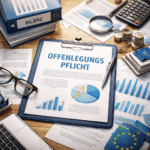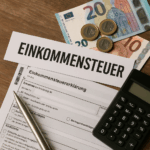Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip)
Das Prinzip der Unternehmensfortführung – auch als Going-Concern-Prinzip bezeichnet – ist ein zentraler Grundsatz der Rechnungslegung. Es besagt, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in absehbarer Zukunft fortsetzen wird und keine Absicht oder Notwendigkeit besteht, den Betrieb einzustellen oder zu liquidieren. Auf dieser Annahme basiert die Erstellung des Jahresabschlusses. Vermögenswerte und Schulden werden somit unter der Prämisse bewertet, dass das Unternehmen weiterhin am Markt tätig bleibt. Nur wenn rechtliche oder tatsächliche Gründe gegen diese Annahme sprechen, muss eine Bewertung zu Liquidationswerten erfolgen.
Bedeutung für die Bilanzierung
Das Going-Concern-Prinzip hat erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung und Darstellung von Vermögenswerten und Schulden. Solange die Fortführung des Unternehmens gesichert ist, werden Vermögensgegenstände zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert und planmäßig über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Diese Methode spiegelt die langfristige Nutzung der Wirtschaftsgüter im laufenden Geschäftsbetrieb wider. Sollte jedoch die Fortführungsannahme wegfallen – etwa im Fall einer drohenden Insolvenz – müssen die Werte auf Basis realistischer Liquidationserlöse angesetzt werden. Diese sind in der Regel deutlich niedriger, was zu einer Reduktion des Eigenkapitals führt.
Voraussetzungen und Prüfungspflichten
Die Annahme der Unternehmensfortführung gilt grundsätzlich, sofern keine gegenteiligen Anzeichen bestehen. Solche Anzeichen können wirtschaftliche Schwierigkeiten, rechtliche Verfahren oder sonstige Umstände sein, die die Fortführung gefährden. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die Annahme der Unternehmensfortführung weiterhin gerechtfertigt ist. Dabei müssen alle verfügbaren Informationen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens berücksichtigt werden – meist über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Bilanzstichtag.
Bestehen Zweifel an der Fortführungsfähigkeit, ist die Geschäftsleitung verpflichtet, diese zu dokumentieren und mögliche Gegenmaßnahmen darzulegen. Auch der Wirtschaftsprüfer hat die Aufgabe, die Angemessenheit der Fortführungsannahme kritisch zu hinterfragen. Stellt er erhebliche Unsicherheiten fest, muss er dies in seinem Prüfungsbericht vermerken und gegebenenfalls einen Hinweis im Bestätigungsvermerk aufnehmen.
Folgen bei Zweifeln an der Fortführung
Wenn ernsthafte Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens bestehen, muss dies im Anhang des Jahresabschlusses offengelegt werden. Typische Indikatoren für eine gefährdete Fortführung sind etwa anhaltende Verluste, eine unzureichende Eigenkapitalquote, erhebliche Liquiditätsengpässe oder der Verlust wichtiger Absatzmärkte. Eine solche Offenlegung soll Transparenz schaffen und den Adressaten des Jahresabschlusses – insbesondere Investoren, Gläubigern und Anteilseignern – ermöglichen, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens realistisch einzuschätzen.
Unterschied zur Liquidationsbewertung
Kommt die Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass eine Unternehmensfortführung nicht mehr realistisch ist, entfällt das Going-Concern-Prinzip. In diesem Fall erfolgt die Bewertung sämtlicher Vermögenswerte auf Basis der voraussichtlichen Veräußerungswerte (Liquidationserlöse). Dies führt regelmäßig zu erheblichen Abschreibungen und einer Verringerung des Eigenkapitals.
Insgesamt stellt das Going-Concern-Prinzip sicher, dass der Jahresabschluss die wirtschaftliche Realität des Unternehmens sachgerecht widerspiegelt – unter der Annahme, dass es weiterhin besteht und seine Geschäfte fortführt. Nur bei gravierenden Krisen oder absehbarer Beendigung der Geschäftstätigkeit muss von dieser Grundannahme abgewichen werden.