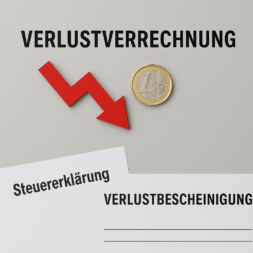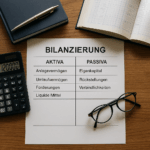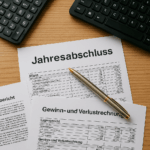Die Verlustverrechnung ist ein wichtiges Instrument im deutschen Steuerrecht, um die steuerliche Belastung zu mindern. Sie ermöglicht es, Verluste aus bestimmten Einkunftsarten mit Gewinnen zu verrechnen. Dadurch verringert sich das zu versteuernde Einkommen. Unterschieden wird zwischen dem horizontalen Verlustausgleich und dem vertikalen Verlustausgleich.
Beim horizontalen Verlustausgleich werden Verluste und Gewinne innerhalb derselben Einkunftsart miteinander verrechnet. Beispielsweise kann ein Verlust aus einer Vermietung mit einem Gewinn aus einer anderen Vermietung gegen gerechnet werden. Der vertikale Verlustausgleich hingegen erlaubt die Verrechnung von Verlusten aus einer Einkunftsart mit Gewinnen aus anderen Einkunftsarten. So kann beispielsweise ein Verlust aus einem Gewerbebetrieb mit einem Gewinn aus Kapitalanlagen verrechnet werden.
Neben der Verrechnung innerhalb eines Jahres gibt es auch die Möglichkeit, Verluste über mehrere Jahre zu berücksichtigen. Das geschieht entweder durch Verlustrücktrag oder Verlustvortrag. Beim Verlustrücktrag wird der Verlust ins vorangegangene Steuerjahr übertragen, um dort gezahlte Steuern teilweise zurückzuerhalten. Aktuell ist dieser Rücktrag auf einen Betrag von bis zu 1.000.000 Euro begrenzt (bei Zusammenveranlagung 2.000.000 Euro).
Der Verlustvortrag ermöglicht es, nicht genutzte Verluste in die folgenden Jahre zu übertragen. Auch hier gilt eine Grenze: Bis zu 1.000.000 Euro können ohne Einschränkung verrechnet werden. Darüber hinausgehende Verluste können nur zu einem Anteil von derzeit 70 % berücksichtigt werden, wobei dieser Satz für die Jahre 2024 bis 2027 auf 75 % erhöht wurde.
Es gibt auch Einschränkungen bei der Verlustverrechnung. Besonders bei Aktiengeschäften dürfen Verluste nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäften verrechnet werden. Verluste aus anderen Kapitalanlagen, wie z. B. aus Fonds oder Anleihen, können hingegen miteinander oder mit anderen Kapitaleinkünften verrechnet werden. Für Termingeschäfte bestanden zeitweise Einschränkungen, die jedoch mittlerweile wieder aufgehoben wurden.
Um die Verrechnung zu organisieren, werden Verluste in sogenannten Verlusttöpfen gesammelt. Dabei unterscheidet man zwischen Aktienverlusttopf und allgemeinem Verlusttopf für sonstige Kapitalanlagen. In der Regel erfolgt die Verrechnung automatisch durch Banken oder Kreditinstitute. Wenn jedoch mehrere Depots bei unterschiedlichen Banken bestehen, kann eine Verlustbescheinigung beantragt werden. Mit dieser Bescheinigung lassen sich die Verluste bei der Steuererklärung berücksichtigen.
Ein Beispiel:
Wer 2024 einen Verlust von 30.000 Euro aus Aktiengeschäften und einen Gewinn von 10.000 Euro aus anderen Kapitalanlagen erzielt, erlebt folgende Verrechnung: Die Bank rechnet den Gewinn automatisch mit den Aktienverlusten auf, obwohl Aktienverluste nur mit Aktiengewinnen verrechnet werden können. Der verbleibende Verlust von 20.000 Euro wird in den nächsten Veranlagungszeitraum vorgetragen.
Insgesamt bietet die Verlustverrechnung Steuerpflichtigen die Möglichkeit, finanzielle Verluste steuerlich optimal zu nutzen.